Kolonialismus, Krieg und Diktatur – Gewalterfahrungen im Historischen Erzählen der deutschsprachigen Literatur nach 1945
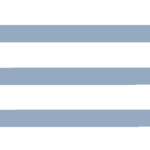 Navigationsmenü
Navigationsmenü

Hier finden Sie die eingesprochene Version des Textes.
Historisches Erzählen/Historischer Roman – Zur Einführung
Das historische Erzählen hat Konjunktur – wieder einmal in seiner noch relativ jungen Geschichte als eigenständige Subgattung. Ihren Siegeszug angetreten hat diese Subgattung in der Form des historischen Romans in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Windschatten des Erfolgs von Walter Scotts Romanen Waverley; or ’Tis Sixty Years Since aus dem Jahr 1814 und Ivanhoe. A Romance von 1819. Die Waverley Novels waren 1821 erstmals in deutscher Übersetzung erschienen, der etwas jüngere Ivanhoe bereits im Jahr zuvor. Als solcher ist der historische Roman allerdings deutlich älter. Bereits in Adelungs Grammatisch-kritischem Wörterbuch der hochdeutschen Mundart von 1777 findet er so unter dem Lemma ,Roman‘ Erwähnung. Überdies hat der historische Roman ein Gegenstück im Geschichtsdrama, das als Bühnendichtung auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken kann.
Fiktion und Geschichte
Wie das Geschichtsdrama bewegt sich das historische Erzählen in einem auch epistemologisch prekären Spannungsfeld von „Ästhetik und Geschichte“[1], insoweit es in einer großen Spannweite literarischer Verfahren (Figurenkonstellation, Erzählstrategien, Raumanordnungen etc.[2]) auf empirisch belegbare Personen, Vorkommnisse oder Ereignisse rekurriert, die in der Vergangenheit spielen, oder zu den Bedingungen des Mediums, in dem erzählt wird, ein Plausibilität bzw. Authentizität beanspruchendes historisches Setting entwirft. Ob und worin sich sein Fiktionalisierungsgrad von dem der Geschichtswissenschaft unterscheidet, die sich dem Vetorecht der Quellen unterwerfen muss, ist immer wieder Gegenstand kontroverser Diskussionen gewesen.[3] Nicht einmal über die Frage des zeitlichen Abstands zwischen den faktualen Ereignissen und ihrer literarischen Nachschrift bestand und besteht in der Gattungstheorie und -poetik ein annähernder Konsens.
Von Anfang an nicht unumstritten war der historische Roman gattungspoetologisch aufgrund seiner Stellung zwischen Faktualität und Fiktionalität, Geschichte (referentialisierbarem Material) und Ästhetik.[4] Lange Zeit war eines der wenigen einnehmenden Argumente für diese Spielart des Erzählens, sie sei dazu in der Lage, Belehrung und Informationsvermittlung in unterhaltsamer Weise an das Lesepublikum zu adressieren (ein in Zeiten der Aufklärung, der Volksbildung und aus der Warte der Didaktik oft wiederholter Aspekt); dazu kam bald ein nationaler und nationalpädagogischer Gesichtspunkt: die Geschichte des eigenen Volkes auszumalen, zu beleben, galt als verdienstvolle Aufgabe; schließlich wurde auch die Möglichkeit einer ‚Verkleidung‘ zeitaktueller Themen im historischen Gewand als mögliches Surplus der Gattung gerade in politischen prekären Zeiten ins Feld geführt.
Gegner der Gattung hingegen wiesen schon früh darauf hin, dass es bei der Behandlung geschichtlicher Stoffe in fiktionaler Form geradezu zwangsläufig zu Konflikten kommen müsse. Diese könnten und dürften nur unter ästhetischen Gesichtspunkten gelöst werden, also zugunsten der Fiktion (womit das entscheidende Argument der Befürworter, die Gattung vermittle historische Information und Bildung, entfällt). Schiller, der bedeutendste Be- und Verarbeiter historischer Stoffe in der deutschen Literatur um 1800, hat dies in aller Deutlichkeit reflektiert. An Goethe schrieb er so am 19. Juli 1799, dass ihn der erste Akt der Maria Stuart sehr viel Zeit gekostet habe, „weil ich den poetischen Kampf mit dem historischen Stoff darinn bestehen mußte und Mühe brauchte, der Phantasie eine Freiheit über die Geschichte zu verschaffen, indem ich zugleich von allem was diese brauchbares hat, Besitz zu nehmen suchte.“[5] Ähnlich äußerte er sich über das Problem von Geschichte und Fiktion im Hinblick auf die Figur des Heerführers Wallenstein in seinem Drama im Brief an Böttiger vom l. März 1799[6] und – generell – in der Vorrede zur Braut von Messina.
In der klassizistischen Kritik wurden diese Argumente wiederholt, vergröbert, breit entfaltet; etwa in Carl Nicolais Versuch einer Theorie des Romans (1819) und in Karl Morgensterns Vortrag Ueber das Wesen des Bildungsromans (1819) oder später bei Karl Immermann in der Vorrede zu seiner Übersetzung von Scotts Roman Ivanhoe (1826), der als im Mittelalter angesiedeltes und in vielem weit eher an bekannte Traditionen (etwa des Ritterromans) angesiedeltes Erzählwerk die Scott-Rezeption in Deutschland beflügelte und anders als die gattungspoetologisch weit radikaleren, in vielem innovativeren Waverley Novels zur Nachahmung einlud. In Deutschland zumindest beginnt die Ausbreitung der Gattung nicht mit den Waverley Novels, deren erster Band erst 1821 ins Deutsche übersetzt wird, auch nicht mit dem ersten in deutscher Sprache erschienenen Werk Scotts, Der Astrolog. Eine caledonische Wundersage (einer Übersetzung des Romans Guy Mannering, or The Astrologer), sondern mit eben der Übersetzung von Ivanhoe (1820).
Diskursgeschichtliche Entwicklung der Gattung
Drei diskursgeschichtliche Entwicklungen gelten als Voraussetzung für die Verbreiterung des historischen Erzählens, dessen Spur sich mit an- und abschwellenden Konjunkturen von der Scott-Rezeption im frühen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, also etwa beispielsweise bis zu Christoph Ransmayrs Die letzte Welt (1998), Thomas Hettches Pfaueninsel (2014) oder Lea Singers La Fenice (2020) zieht, wobei historisches Erzählen im Realismus, vertreten hier etwa durch Adalbert Stifters Witiko (1867), Gustav Freytags Die Ahnen (1872-1881) oder Theodor Fontanes Schach von Wuthenow (1883), in der Literatur der Weimarer Republik – hier z.B. Reinhold Schneiders Philipp der Zweite oder Religion und Macht (1931), Werner Bergengruens Herzog Karl der Kühne oder Gemüt und Schicksal (1930) oder Gertrud von Le Forts Der Papst aus dem Ghetto. Die Legende des Geschlechtes Pier Leone (1930) – und zumal des Exils, hier zumal Heinrich Manns Die Jugend des Königs Henri Quatre/Die Vollendung des Königs Henri Quatre (1935-38) und Thomas Manns Joseph und seine Brüder (1933-43), jeweils wichtige Wegmarken in der Gattungsentwicklung darstellen. Diese diskursgeschichtlichen Entwicklungen sind:
der Aufstieg der Geschichtsschreibung zur Wissenschaft im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, beginnend etwa mit Edward Gibbons History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776-1789); in Deutschland mit Justus Mösers Osnabrückische Geschichte (1768), dann die großen Geschichtswerke Friedrich Schillers wie die Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung (1788) und die Geschichte des dreißigjährigen Krieges (1792) bis hin zu Friedrich Raumers Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit (1823-25);
die in etwa zeitgleiche Ausformung der neueren Geschichtsphilosophie als Fortschrittsgeschichte durch Voltaire, Hume, Herder, Hegel, Feuerbach, Marx u.a., welche die nun als menschengemacht und menschengeformt gedachte Erfahrungsgeschichte als Prozess der Entfaltung von Vernunft und menschlicher Freiheit in ihrer jeweiligen Einmaligkeit zu betrachten aufforderte;
die Ausbreitung des Historismus im 19. Jahrhundert, die entscheidend dann auch zur Popularisierung des historischen Romans beitrug, der gattungspoetologisch immer wieder mit dem Argument gegen den (tatsächlich oder vermeintlich) kulissenhaften historistischen Roman abgegrenzt und aufgewertet wurde, letzterer entzeitlichte das Erzählen durch Verfahren eines ‚als ob‘, die Evidenz und Authentizität lediglich simulierten, indem sie einen vermeintlichen Zeitgeist heraufbeschwörten.
***
Historiographie und historisches Erzählen
Die Geschichtswissenschaft als solche hat überraschenderweise die Beschäftigung mit dem historischen Roman weitgehend der Literaturwissenschaft überlassen. Standardwerke zum historischen Erzählen im Allgemeinen und dem historischen Roman im Besonderen stammen so in der Regel auch nicht etwa von Historiker*innen, sondern von Literaturwissenschaftler*innen (Lukács 1955[7], Hughes 1993[8]; Aust 1994[9], Fulda/Tschopp 2002[10], Potthast 2007[11], Geppert 2009[12], Schilling 2012; Fulda/Jaeger 2021[13], Paul/Faber 2013[14]; zu den populären Geschichtsromanen siehe auch Jürgensen 2006[15]; Fulda 2013[16]); eine der wenigen Ausnahmen stellt Johannes Süßmanns Untersuchung Geschichtsschreibung oder Roman? aus dem Jahr 2000 dar.[17]
Das mag einerseits mit der fachwissenschaftlichen Ablehnung fiktionaler Gattungen zusammenhängen, an der auch die insbesondere durch Hayden White[18] und Richard J. Evans 1998[19] vorangetriebene geschichtstheoretische Reflexion der imaginativen und konstruktiven Elemente historischer Erkenntnis wenig geändert zu haben scheint. Andererseits bieten sich historische Romane insbesondere für diskursanalytische Fragestellungen an, da sie Weltbilder und Wissensformen in besonderer Deutlichkeit und Suggestionskraft formulieren und aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Auflagen das kollektive Geschichtsbewusstsein stärker prägen als viele andere mögliche Medien und Gattungen – und sicherlich mehr als wissenschaftliche historische Fachbücher.
Hier öffnet sich der Horizont für ein Grundproblem nicht allein des Erzählens von Geschichte in Geschichten. Literatur kartographiert, chronologisiert, kategorisiert und imaginiert Geschichte, und sie tut dies, indem sie ‚Fiktionen‘ produziert. Bezogen auf die Historiographie hat Reinhart Koselleck zu solchen Fiktionalisierungsprozessen angemerkt, dass die „Totalität der Vergangenheit“ sich „nicht wiederherstellen“ lasse; dies sei nicht möglich, da die Vergangenheit ja nun einmal „unwiderrufbar vergangen“ sei. Den Schreibenden zwinge dies dazu, „den fiktiven Charakter vergangener Tatsächlichkeit anzuerkennen“, um historische Aussagen „theoretisch absichern zu können“[20]. Ist allein schon der auf die Tatsächlichkeit bezogene Status der res gestae (also dessen was sich ereignet hat oder geschehen ist) als einer der Sprache vorgängigen Authentizität fraglich, gilt dies umso mehr für die historia rerum gestarum (also die Wiedergabe des Geschehenen) im engeren und die Suggestion, durch Geschichten ‚wahr‘ zu sprechen, im weiteren Sinn. Dabei läuft in literarischen Konstruktionen des Vergangenen stets ein Wissen darum mit, dass allein Erinnern Zukunft ermöglicht.
Bereits die Odyssee erzählt davon im 11. Gesang, der Nékyia, mit der Hadesfahrt des Fürsten von Ithaka (die als nachfragende ‚Schau‘ des Vergangenen und damit des gewissermaßen ‚hinter‘ dem Protagonisten liegenden Geschehens zwar als Gang zu den Toten in Szene gesetzt wird, letztlich aber Odysseus ‚nur‘ in eine Wirklichkeitssphäre führt, die sich am ‚Rand‘ mit der Welt der Lebenden berührt). Die von Odysseus an die Toten gerichtete Bitte um Wegleitung (Orientierung) schafft als Vergewisserung der Vergangenheit Zukunft. Dass es der auch über den leiblichen Tod hinaus mit der Fähigkeit der Zukunftsschau begabte thebäische Seher Teiresias ist, dessen vom Vergessen bedrohtes Wissen sich Odysseus in erster Linie dabei zu eigen macht, ist ein dramaturgischer Kniff mit weitreichender Bedeutung: Odysseus‘ Jenseitsreise ist als Befragung der Toten Archäologie, die das ‚Jenseits‘ (die Vergangenheit) auf ein Gegenüber, nämlich ein Zukünftiges (die Heimkehr) hin konzipiert, wobei Odysseus im epischen Gesamtrahmen als Erzähler seiner selbst erzählt, was wiederum ihm die Toten in Gestalt des inspirierten Sehers erzählt und damit an Wissen preisgegeben haben.
Die Episode wirft ein Schlaglicht auf den Umstand, dass historische Ereignisse, wenn sie erzählt werden, ‚empfangene‘, ‚vermittelte‘ Ereignisse sind. Geschichte wird im Erzählen somit in gleich doppelter Weise ‚entfernt‘: durch den historischen Abstand und durch seine mediale Vermittlung, die an der Deutung der Vergangenheit gleichsam ‚mitschreibt‘. Literaturtheoretisch gesehen stellt das historische Erzählen ein die Zeiten überbrückendes und nicht zuletzt ein mediales Sprechen im Namen eines Anderen dar, das in dieser Vielschichtigkeit und historischen Vielfalt Narrativität und Geschichtlichkeit immer wieder neu verfügbar macht. Wenn Hugo Aust davon spricht, der historische Roman entfalte sich „im ‚Dreiländereck‘ der autonomen Poesie, der exakten Geschichtswissenschaft und der legitimierenden Didaktik“[21], wäre dies zumindest dahingehend zu präzisieren, dass auch der historische Roman streng genommen nicht Geschehenes, sondern lediglich überlieferte Geschichte deutet und dadurch Vorstellungen von der Vergangenheit erzeugt.
Ästhetische Verfahren der Historisierung nach 1945
All dies macht es gleichsam zum Gebot der Lektüre, das ästhetische Verfahren mit zu reflektieren. Für die Literatur nach 1945 und in der Gegenwart, auf die sich das Textpaket „Gewalterfahrungen im historischen Erzählen der deutschsprachigen Literatur seit 1945“ konzentriert, trifft dies in noch einmal besonderer Weise zu, treiben in dieser Literatur doch Historisierungsprozesse – hier im Sinne der erinnernden Konstruktion des Vergangenen – in besonders augenfälliger Weise das Erzählgeschehen an. Die deutschsprachige Literatur der vergangenen Jahrzehnte knüpft hier nicht nur an eigene literarische Traditionen im Umgang mit der Geschichte an; sie schreibt sich damit auch (und vielleicht wichtiger) unmittelbar in gesellschaftliche Aushandlungsprozesse vergangenheits-politischer Debatten ein, und sie ‚schreibt‘ diese gleichsam mit.
Dieser Vorgang einer solcherart doppelten (In-)Skription bewegt sich zwischen zwei Polen: einerseits dem Versuch, Narrative erzählerisch zu etablieren und damit bestimmte Geschichtsbilder zu vermitteln, andererseits bestehende Narrative und Bilder durch die erzählerische Entfaltung von Mehrdeutigkeiten, Ambivalenzen und Ambiguitäten zu dekonstruieren. Auf ihre Weise tritt das historische Erzählen als Erzählen von Geschichte in Geschichten mit seinen spezifisch eigenen Perspektiven, Interessen, Verfahren und auch Logiken des Vergangenheitsbezugs damit neben die akademische Geschichtswissenschaft als Produzentin von Wissen und Einsichten über Vergangenes, von historischen Sinngebungen sowie von Theorien und Methoden,[22] ohne jeweils fest umhegte Felder zu bestellen – weder solche, die inhaltlich, noch solche, die bereits methodisch-kategorial klar definiert wären.
Auffallend allerdings ist die Häufung, mit der das historische Erzählen zumal seit der Milleniumswende[23] im Literaturbetrieb präsent ist. Insbesondere Formgebungsverfahren individueller bzw. generationenspezifischer Erinnerungen und narrative Inszenierungen von Geschichte in realistischer, fantastischer, trivial-konsumtauglicher, traditioneller und avantgardistischer Gestalt wie sie beispielsweise in Arno Geigers Es geht uns gut (2005), Marcel Beyers Spione (2000), Moritz Rinkes Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel (2010), Sibylle Lewitscharoffs Blumenberg (2011) oder Per Leos Flut und Boden (2014) begegnen, bilden neben autofiktionalen Erzählungen ein wichtigstes Marktsegment, auch in der Form eines pseudo-historischen Erzählens wie in Christian Krachts Imperium (2012) oder in der Kombination von Fantastik und kontrafaktischem Erzählen wie beispielsweise in Thomas Glavinics Romanen Die Arbeit der Nacht (2006) und Das Leben der Wünsche (2009).
Augenfällig ist in diesem Zusammenhang bei aller Heterogenität der literarischen Verfahrensweisen im Umgang mit der Geschichte gerade die Zunahme metafiktionaler und selbstreferentieller Schreibweisen (Multiperspektivität, polyphones Erzählen, unreliable speech, mediale Verfransungen etc.)[24] – und dies nicht allein in denjenigen Teilsegmenten des historischen Erzählens, die Nationalsozialismus und Shoah in der ein oder anderen Weise zum Gegenstand des Erzählens machen wie Marcel Beyer in Flughunde (1995), Kevin Vennemann in Nahe Jedenew (2005) und Mara Kogoj (2007) sowie Takis Würger in Stella (2019), oder die sich mit dem deutschen Kolonialismus auseinandersetzen; hier zu nennen wären beispielsweise Martin Mosebach mit Der Nebelfürst (2000), Gerhard Seyfried mit Herero (2003) und Katharina Döbler mit Dein ist das Reich (2021). In der ethisch fundierten bzw. ‚eingehegten‘ Rückbesinnung auf den Konstruktionscharakter von Geschichte lässt sich in diesem Zusammenhang ein zentrales poetisches und poetologisches Leittheorem des historisch-fiktionalen Erzählens in der Gegenwart erkennen, das die sprachliche Verfasstheit der (re-)konstruierten Wirklichkeiten und Erinnerungen mitreflektiert, wie dies der Fall ist – auch dies nur exemplarisch – in Norbert Gstreins Die englischen Jahre (1999), Robert Menasses Die Vertreibung aus der Hölle (2001), Felicitas Hoppes Johanna (2006) und Marcel Beyers Kaltenburg (2008).
Wenig Beachtung gefunden hat in der Forschung die eigentümliche Gemengelage von Faktualität und Fiktionalität in den Erzählwelten der Fantasy und des populären Geschichtsromans, die sich nicht mehr oder allenfalls nur sehr bedingt einer Erkenntnisfunktion von Geschichte verpflichtet fühlen. Während historische Romane den Anschein historischer Faktizität oder zumindest von historischer Plausibilität aufrecht erhalten[25], schaffen Fantasy-Romane Schwellen- bzw. Unbestimmtheitsräume zwischen zwischen Faktischem und Mythischem [26]; gleichwohl arbeiten auch sie mit Referenzen auf Historisches. Umgekehrt sickern zunehmend auch in die Authentizitätskonstruktionen des populären historischen Erzählens Elemente des Fantastischen ein. Indem sie in pseudohistorischem Sujet auf entsprechungslosen Gesetzmäßigkeiten und Kausalitäten aufbauende ästhetische Ordnungen ganz eigenen Rechts entwerfen, haben auch Fantasy- und populäre Geschichtsromane Teil an dem, was gegenwärtig als Geschichtskultur[27] diskutiert wird: dem dynamischen Gesamt der als solche jeweils kontingenten Ausprägungen von Grunddimensionen historischen Denkens und Handelns innerhalb einer Gesellschaft, die überwiegend nicht mehr als kontingent wahrgenommen werden, sondern als selbstverständlich gelten.
Das Textpaket
Der Prämisse folgend, dass die Geschichte wie jede Wirklichkeit eine sprachliche Hervorbringung ist, die fortwährend durch die Rede über sie erzeugt wird, richtet sich der Fokus der Nachfragen im Rahmen des hier vorgelegten Textpakets am Beispiel von fünf Schlüsselwerken der deutschsprachigen Literatur seit den ausgehenden 1950er Jahren, die Gewalterfahrungen im historischen Sujet reflektieren – Günter Grass‘ Die Blechtrommel (1959), Uwe Johnsons Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl (1970-1983), Peter Weiss‘ Die Ästhetik des Widerstands (1975-1981), Uwe Timms Morenga (1978) und Herta Müllers Atemschaukel (2009) – u.a. auf die narrative Konstruktion von Geschichte in den Texten und die theoretischen sowie methodischen Prämissen der Analyse dieser Konstruktionspolitiken. Aus literaturwissenschaftlicher Perspektive ist es notwendig, die verschiedenen Sprechweisen des historischen Erzählens von Geschichte und mit Geschichte kontextuell präziser zu bestimmen und in ihrer kulturellen Vergleichbarkeit, systematischen Verallgemeinerbarkeit und Aktualität zu reflektieren. Aus literaturgeschichtlicher Sicht wiederum lässt sich fragen, wie narrative Geschichtsdiskurse in Erzähltexten modelliert, weitergetragen und möglicherweise aufgebrochen werden.
Leitend für die Arbeit mit den zur Diskussion gestellten Romanen sind von hier aus Fragen, die das Verhältnis von Narrativität und Geschichtskonstruktion betreffen. Wie also ist historisches Erzählen heute sprachlich kodiert und ästhetisch konstruiert? Wie und mit welchen narrativen Mitteln entfalten die Texte ihre Sicht auf Geschichte und Gegenwart? Wovon und wie wird mit anderen Worten erzählt? Und was macht die ästhetische Indienstnahme von Narrativen und Topoi historischen Erzählens mit dem Erzählen selbst?
Norbert Otto Eke
Literaturnachweise:
[1] Norbert Otto Eke/Hartmut Steinecke: Der historische Roman der frühen Restaurationszeit. Zur Einführung. In: Geschichten aus (der) Geschichte. Zum Stand des historischen Erzählens im Deutschland der frühen Restaurationszeit. Hg. von Norbert Otto Eke und Hartmut Steinecke. München 1994. S. 7-16, hier S. 10.
[2] Vgl. Hermann J. Sottong: Transformation und Reaktion. Historisches Erzählen von der Goethezeit zum Realismus. München 1992. S. 15-18.
[3] Z. B. Johannes Süßmann: Geschichtsschreibung oder Roman? Zur Konstitutionslogik von Geschichtserzählungen zwischen Schiller und Ranke (1780-1824). Stuttgart 2000.
[4] Zum Verhältnis von Fiktionalität und Faktualität siehe beispielsweise Frank Zipfel: Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität. Analysen zur Fiktion in der Literatur und zum Fiktionsbegriff in der Literaturwissenschaft. Berlin 2001.
[5] Friedrich Schiller: Werke. Nationalausgabe Hg. von Lieselotte Blumenthal und Benno von Wiese. Bd. 30: Briefwechsel. Schillers Briefe 1.11.1798 – 31.12.1800. Hg. von Norbert Oellers und Frithjof Stock. Weimar 1985. S. 73.
[6] Ebd., S. 33.
[7] Georg Lukács: Der historische Roman. Berlin/DDR 1955.
[8] Helen Hughes: The Historical Romance. London, New York 1993.
[9] Hugo Aust: Der historische Roman. Stuttgart, Weimar 1994.
[10] Daniel Fulda/Silvia Serena Tschopp (Hg.): Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Berlin/New York 2002.
[11] Barbara Potthast: Die Ganzheit der Geschichte. Historische Romane im 19. Jahrhundert. Göttingen 2007.
[12] Hans Vilmar Geppert: Der historische Roman. Geschichte umerzählt – von Walter Scott bis zur Gegenwart. Tübingen 2009.
[13] Daniel Fulda/Stephan Jaeger (Hg.): Romanhaftes Erzählen von Geschichte. Vergegenwärtigte Vergangenheiten im beginnenden 21. Jahrhundert. Berlin/Boston 2019.
[14] Ina Ulrike Paul/Richard Faber (Hg.): Der historische Roman zwischen Kunst, Ideologie und Wissenschaft. Würzburg 2013.
[15] Christoph Jürgensen (Hg.): Die Lieblingsbücher der Deutschen. Kiel 2006.
[16] Daniel Fulda: Zeitreisen. Verbreiterungen der Gegenwart im populären Geschichtsroman. In: Poetiken der Gegenwart. Deutschsprachige Romane nach 2000. Hg. von Silke Horstkotte und Leonhard Herrmann. Berlin/Boston 2013. S. 189-211.
[17] Johannes Süßmann: Geschichtsschreibung oder Roman? Zur Konstitutionslogik von Geschichtserzählungen zwischen Schiller und Ranke (1780–1824). Stuttgart 2000.
[18] Hayden White: Auch Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen. Studien zur Tropologie des historischen Diskurses. Stuttgart 1986; Ders.: Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. Frankfurt a. M. 2008.
[19] Richard J. Evans: Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis. Frankfurt a. M./New York 1998.
[20] Reinhart Koselleck: Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft. In: Ders.: Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt a. M 2000, S. 298-316, hier S. 315f
[21] Hugo Aust: Der historische Roman. Stuttgart/Weimar 1994. S. VII.
[22] Z. B. Wolfgang Hasberg: Erinnerungskultur – Geschichtskultur, Kulturelles Gedächtnis – Geschichtsbewusstsein. 10 Aphorismen zu begrifflichen Problemfeldern. In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 3, 2004. S. 198-207; Marko Demantowsky: „Public History“ – Aufhebung einer deutschsprachigen Debatte? In: Public History Weekly 29.01.2015. URL: https://public-history-weekly.degruyter.com/3-2015-2/public-history-sublation-german-debate.
[23] Siehe dazu u.a. Stephanie Catani: Geschichte im Text. Geschichtsbegriff und Historisierungsverfahren in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Tübingen 2016.
[24] Vgl. dazu Ansgar Nünning: Von historischer Fiktion zu historiographischer Metafiktion. Bd. 1. Theorie, Typologie und Poetik des historischen Romans. Trier 1995; Erik Schilling: Der historische Roman seit der Postmoderne. Umberto Eco und die deutsche Literatur. Heidelberg 2012.
[25] Jörn Rüsen: Grundzüge einer Historik. Teil: 1: Historische Vernunft: die Grundlagen der Geschichtswissenschaft. Göttingen 1983. S. 85-116.
[26] Clemens Ruthner: Phantastik und/als Liminalität. In: Wilde Lektüren. Literatur und Leidenschaft. Hg. von Wiebke Amthor, Almut Hille und Susanne Scharnowski. Bielefeld 2012. S. 35-52.
[27] Vadim Oswalt/Hans-Jürgen Pandel (Hg.): Geschichtskultur. Die Anwesenheit von Vergangenheit in der Gegenwart. Schwalbach 2009.






