Kolonialismus, Krieg und Diktatur – Gewalterfahrungen im Historischen Erzählen der deutschsprachigen Literatur nach 1945
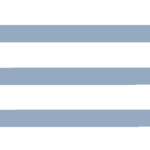 Navigationsmenü
Navigationsmenü
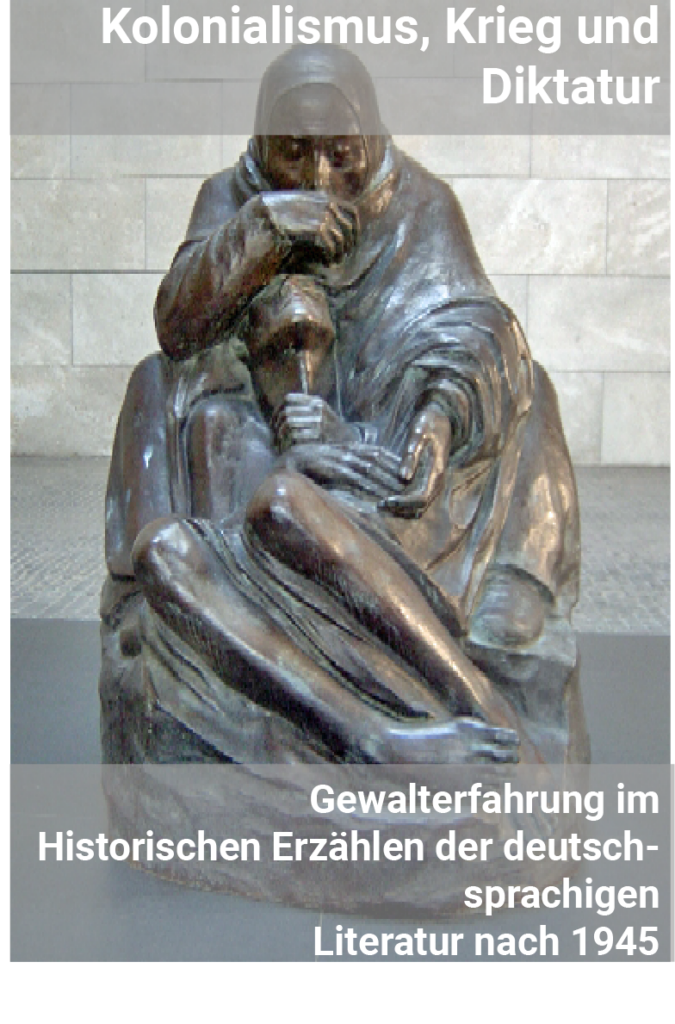

Der Kurs hat die Darstellungsproblematiken von Gewalterfahrungen im ‚Historischen Erzählen‘ im Kontext von Kolonialismus, Krieg und Diktatur in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 zum Gegenstand. Exemplarisch und repräsentativ stehen die hier vorgestellten Romane für literarische Geschichtskonstruktion(en) des Kolonialismus, des Kriegs und der Diktatur und ihre jeweiligen Auswirkungen auf nachfolgende Zeiten, Generationen und Narrative. Die Auseinandersetzung mit der Shoa und der nationalsozialistischen Vergangenheit, die Aufarbeitung des kolonialen Genozids, Zeitzeugenschaft, Erinnerungen und Erfahrungen politischer „Lagerhaft“ sind für die deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert zentrale Gegenstände. Das historische Erzählen im Roman kann dabei – anders als die Geschichtswissenschaft – in seinen figuralen Konstellationen oder durch die Offenlegung der Spannung zwischen einer fragwürdigen Authentizität und Faktizität historischer Dokumente hegemoniale Geschichtsbilder in Frage stellen und marginalisierte Wahrnehmungen historischer Erfahrung artikulieren. Ihnen soll damit ein Einstieg in die Komplexität der spezifischen Produktions- und Rezeptionsbedingungen und -prozesse des ‚Historischen Erzählens‘ ermöglicht werden.
Komplexität tritt in den ausgewählten Texten durch eine Vielfalt literarischer Verfahrensweisen zutage: plurale und mehrfach überlagernde Handlungs-, Zeit- und Raumebenen, häufige Perspektiv- und Figurenwechsel (auch mehrerer Erzähler- und Reflektorfiguren), neue narrative und ästhetische Formen, die zu ganz eigenen Textbewegungen (Buschmeier/Dembeck 2007) werden und mehrdimensional zwischen Fiktion und Wirklichkeit rangieren.
Die Multiperspektivität und die Brüche überlagernder Erinnerungskulturen von Geschichte und Geschichtskonstruktion(en) werden dabei einerseits erst durch literarische Verfahren der Medialität, der Metafiktionalität und der Mehrdeutigkeiten im historischen Erzählen sichtbar. Andererseits führen in schonungsloser Unmittelbarkeit erzählte Formen von historischer Gewalt zu einer identifikatorischen Lektüre (Schutte 2018, S. 63), die diese Gewalterfahrungen in der Vorstellung des Lesenden nahezu sinnlich spürbar werden lässt. Zwischen diesen beiden extremen Polen bewegt sich das Spektrum von Produktions- und Rezeptionsweisen historischen Erzählens, das in den einzelnen Romanen des Textpakets auf je eigene spezifische Weise funktioniert und dabei Erinnerungs- und Reflexionsprozesse neu und jeweils anders in Gang setzt. Hegemoniale, tradierte und festgefahrene Deutungsmuster werden beispielsweise durch plurale Erinnerungsbruchstücke und Facetten von (sekundärer) Zeugenschaft wie in „Atemschaukel“ wieder aufgebrochen. De- und Rekonstruktionen historischer Wirklichkeit praktiziert Uwe Timms Roman „Morenga“ und mehrstimmiges, überlagerndes und transformiertes Erinnern findet man in Uwe Johnsons „Jahrestagen“. In Peter Weiss‘ „Ästhetik des Widerstands“ oder „Laokoon“ stehen die Bild- und Sprachfindung der Katastrophe und das Resistenzpotential der Kunst (Hofmann 1990, S. 40) im Fokus. Günter Grass‘ „Blechtrommel“ thematisiert das Aufkommen des Nationalsozialismus und behandelt Fragen zwischen individueller und kollektiver Schuld.
Das Verhältnis zwischen Geschichte und Literatur, zwischen historischen Wirklichkeitsbezügen von und in Literatur auf der einen Seite und der Fiktionalisierung, Diskursivität und Narrativität von Geschichtskonstruktion(en) auf der anderen wird in diesem Textpaket unter der Perspektive verschiedener theoretischer, narratologischer, medialer und ästhetischer Zugänge reflektiert.
Nach einer theoretischen Einführung in das „Historische Erzählen/Historischer Roman“ von Norbert Otto Eke finden Sie neben Expertengesprächen zu Uwe Johnsons „Jahrestagen. Aus dem Leben der Gesine Cresspahl“ und Günter Grass‘ „Die Blechtrommel“ auch multimediale Inhalte zu den einzelnen Autor:innen, deren Leben ebenso im Kontext geschichtlicher Erfahrung und realhistorischer Zeiträume gesehen werden muss wie ihr Werk. Im Kurs haben wir die Texte für Sie chronologisch angeordnet. Bitte folgen Sie der nummerierten Anordnung der Tabs in Ihren Lektüren, in die verschiedene Aufgabentypen eingebettet sind. Diese reichen von Erschließungsaufgaben über interaktive Formate bis hin zu kleineren Schreibaufgaben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und spannende Einsichten bei der Lektüre des Textpakets.
Alexa Silke Lucke
Literatur
Buschmeier, Matthias/Dembeck, Till (Hg.): Textbewegungen 1800/1900, Würzburg: Königshausen & Neumann 2007.
Hofmann, Michael: Ästhetische Erfahrung in der historischen Krise. Eine Untersuchung zum Kunst- und Literaturverständnis in Peter Weiss‘ Roman „Die Ästhetik des Widerstands“, Bonn: Bouvier 1990.
Schutte, Jürgen: Register zur Ästhetik des Widerstands von Peter Weiss, Berlin: Verbrecher Verlag 2018






