Kolonialismus, Krieg und Diktatur – Gewalterfahrungen im Historischen Erzählen der deutschsprachigen Literatur nach 1945
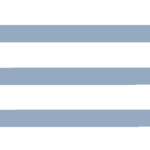 Navigationsmenü
Navigationsmenü
Klicken Sie hier, um sich den Text vorlesen zu lassen

Der von Ihnen gelesene Roman „Die Blechtrommel“ bildet den Auftakt der sogenannten „Danziger Trilogie“, einer Sammlung, die zudem Günter Grass’ Novelle „Katz und Maus“ aus dem Jahr 1961 und seinen 1963 erschienenen Roman „Hundejahre“ umfasst. Obwohl sie kurz nacheinander veröffentlicht wurden, handelt es sich um drei inhaltlich selbstständige Werke, die allerdings in mehrfacher Hinsicht miteinander verwoben sind. Dies bewog den Literaturwissenschaftler John Reddick im Jahr 1975 dazu, die Werke unter dem Begriff „Danzig Trilogy“ zu fassen. Grass selbst prägte den rasch ins Deutsche adaptierten Begriff nicht, betonte aber stets den Zusammenhang zwischen den Werken (vgl. Neuhaus 2010, S. 42). Der Begriff hat sich insofern langfristig etabliert, als Buchausgaben vorliegen, die alle drei Texte beinhalten und mit dem Titel „Danziger Trilogie“ versehen sind. 1980 brachte der Luchterhand Literaturverlag, in dem Grass’ Werke erstveröffentlicht wurden, eine einmalige Sonderausgabe unter dem Titel „Danziger Trilogie“ heraus. 1996 erschien im Steidl-Verlag, zu dem Grass in den 1990er-Jahren wechselte, eine Ausgabe, gefolgt von einer weiteren Veröffentlichung im dtv-Verlag im Jahr 1997.
Strukturelle Verbindungen der Werke
Wie schon angedeutet, bilden die Werke der „Danziger Trilogie“ inhaltlich selbstständige und in sich abgeschlossene Handlungen, sind aber durch einen größeren Zusammenhang von Ereignissen, Zeitumständen und Figuren miteinander verbunden. Dies spiegelt sich zum einen in der strukturellen Gestaltung der Werke wider: Sowohl „Die Blechtrommel“ als auch „Hundejahre“ sind in drei Teile gegliedert, die sich der Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit widmen, „Katz und Maus“ entspricht gemäß ihrer Positionierung zwischen den Romanen dem zweiten Teil und ist im Kriegsgeschehen situiert (vgl. Moser 2000, S. 27). Zum anderen wird der übergreifende Charakter der Werke insbesondere durch das Auftreten bzw. die Wiederkehr einiger Figuren über die Einzelwerke und teilweise sogar über die „Danziger Trilogie“ hinaus gewährleistet. Dies kann exemplarisch an dem Erzähler der auftaktgebenden „Blechtrommel“, Oskar Matzerath, nachgezeichnet werden. So begegnet der Erzähler Heinz Pilenz in „Katz und Maus“ „einem vielleicht dreijährigen Jungen, der nicht zu den Großmüttern gehören wollte, sondern eine Kindertrommel, die aber still blieb, bei sich führte“ („Katz und Maus“, S. 128), und Harry Liebenau, der Erzähler des zweiten Buches des Romans „Hundejahre“, vernimmt den Klang einer „Kinderblechtrommel“ und schließt daraus, dass es sich um den „Sohn des Kolonialwarenhändlers“ („Hundejahre“, S. 168) handele. Teilweise treten die Figuren nur indirekt auf; so erwähnt Liebenau in seinen Briefen „das Stadttheater, wie Herr Matzerath es in seinem Buch vom Stockturm aus beschrieben hat“ (ebd., S. 302), und validiert damit Oskars Beschreibung des Dresdener Stadttheaters im Kapitel „Fernwirkender Gesang vom Stockturm aus gesungen“ im ersten Teil der „Blechtrommel“ (vgl. von Schilling 2002, S. 82). Hier findet zudem eine intertextuelle Bezugnahme statt, da mit der Erwähnung des „Buch[es]“ explizit auf den zuvor veröffentlichten Roman „Die Blechtrommel“ verwiesen wird. Zahlreiche weitere Figuren treten in den Werken wiederholt auf, so – um nur ein Beispiel zu nennen – Störtebeker, der Anführer der „Stäuber“-Bande in der „Blechtrommel“, der in „Katz und Maus“, „Hundejahre“ und als Eberhard Starusch in Grass’ 1969 veröffentlichten Roman „örtlich betäubt“ erscheint (vgl. Neuhaus 2010, S. 130). Auch in seinen deutlich später erschienenen Werken wie im Roman „Der Butt“ (1977) oder „Im Krebsgang“ aus dem Jahr 2002 streut Grass Referenzen zur „Danziger Trilogie“ ein (vgl. ebd., S. 25). Aus diesen Gründen empfiehlt sich eine chronologische Lektüre der Werke nach ihrer Veröffentlichung.
Inhalt
In der Novelle „Katz und Maus“ blickt der Erzähler Heinz Pilenz auf die ambivalente Beziehung zu seinem Schulfreund und sozialen Außenseiter Joachim Mahlke zurück. Dessen Außenseiterrolle wird nachhaltig etabliert, als Pilenz ihn und andere Mitschüler:innen auf seinen großen Adamsapfel aufmerksam macht. Mahlkes stetiger Versuch, seine ihm auferlegte Andersartigkeit durch Mutproben und besondere Leistungen zu kompensieren, endet schließlich in einem Tauchgang, von dem er nicht wiederkehrt.
Im Roman „Hundejahre“ präsentieren drei Erzähler rückblickend drei unterschiedliche Perspektiven auf die Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit, die anhand der Geschichte einer ebenfalls ambivalenten Freundschaft zwischen den Erzählern Eduard Amsel und Walter Matern entwickelt werden. Eduard Amsel, ein Künstler jüdischer Herkunft, erzählt im ersten Buch von seinem Leben unter dem nationalsozialistischen Regime. Im zweiten Buch erfahren wir von den Erinnerungen Harry Liebenaus, der die Rolle eines Mitläufers einnimmt. Das dritte Buch präsentiert schließlich die Erzählperspektive Walter Materns in seiner Rolle als Täter.
Zentrale Themen und der Schauplatz Danzig
Was macht die Werke nun zu einer Trilogie? Zunächst besteht der offenkundigste Punkt darin, dass sie sich den Schauplatz Danzig teilen, Grass’ Geburtsstadt. Neben der persönlichen, emotionalen Bedeutung betonte Grass immer wieder den durch geographische Lage und Geschichte – dies werden Sie in einer Einheit zur Geschichte der Stadt Danzig erfahren – gegebenen „Repräsentativcharakter“ (Neuhaus 2010, S. 43) der Stadt. Alles, was in der „Danziger Trilogie“ aufgrund der Verortung der Handlungen in Danzig zunächst als lokales Phänomen erscheint, wird damit auf das gesamte historische Geschehen übertragbar. Dies bringt eine nächste, für das Verständnis der Werke entscheidende Gemeinsamkeit hervor: Die Figuren sind allesamt im Kleinbürgertum angesiedelt. Das inkludiert auch die insgesamt fünf Erzähler, die beispielsweise als Sohn eines Kolonialwarenhändlers (i.e. Matzerath) oder Tischlers (i.e. Liebenau) in kleinbürgerliche Familien geboren werden. Die Erzähler erinnern sich von einem Zeitpunkt, der ungefähr in die Zeit der Abfassung des jeweiligen Werkes fällt, an die Jahrzehnte zuvor. So erstreckt sich der im Jahr 1954 erzählte historische Erinnerungszeitraum der „Blechtrommel“ von 1899 bis 1952. Auch in „Hundejahre“ werden sich zur Jahreswende 1960/61 mehrerer Jahrzehnte (1917 bis Anfang der 1960er Jahre) erinnert, bei „Katz und Maus“ beschränkt sich der Erzähler im Jahr 1959 auf seine Erinnerungen im Zeitraum um 1940. Die fünf Erzähler waren entweder „durch Flucht in die Kunst, als Mitläufer oder Täter in das Geschehen von 1933-1945 involviert“ (ebd.) und schreiben retrospektiv aus einer Schuldposition heraus. Dies gilt auch für den jüdischen, teils opportunistischen Erzähler Amsel, der die Realität durch die Flucht in die Kunst in Form des Baus von Vogelscheuchen verdrängt, gleichzeitig aber bereit ist, seinen Freund Matern zum Eintritt in die SA zwecks Zugang zu den Uniformen für seine Vogelscheuchen zu überreden, und während des Nationalsozialismus schließlich ein Fronttheater zur Unterhaltung der Soldaten leitet (vgl. Neuhaus, S. 116f.). Somit wird die Frage nach der individuellen Schuld und die Ablehnung der Kollektivschuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus verhandelt. Denn gerade das Kleinbürgertum stellte, sei es durch Zustimmung, Billigung oder Wegsehen, „eine den Nationalsozialismus tragende Schicht“ (Neuhaus 2010, S. 45) dar. Zu diesem Zwecke entwickelt Grass das Aufkommen und die Festigung des Nationalsozialismus in der „Danziger Trilogie“ anhand der Darstellung der kleinbürgerlichen Lebenswirklichkeit (vgl. ebd.). Historische Ereignisse werden dabei stets mit privaten vermischt; so zum Beispiel in der „Blechtrommel“, wenn Oskar Matzerath die Niederlage des Deutschen Afrikakorps im Jahr 1943 zeitlich mit dem Ende von Kurts Keuchhusten gleichsetzt (vgl. „Die Blechtrommel“, S. 399).
Kritik an der Vergangenheitsbewältigung
Um die Quintessenz der „Danziger Trilogie“ mit den Worten Grass’ aus dem Jahr 1975 zu resümieren:
Sicher kam es mir bei der „Blechtrommel“, bei „Katz und Maus“ und „Hundejahre“ darauf an, die damals schon beginnende – nein, die in den sechziger Jahren wirklich akute Dämonisierung des Nationalsozialismus zu zerstören. Man hatte es sich fein eingerichtet: Das wären böse Mächte gewesen, hieß es, die die Deutschen verführt hätten. Man konnte geradezu an dunkle Erdgeister denken, die bei Nacht und Nebel die an sich braven und redlichen Deutschen in das Verbrechen hineingedrängt haben sollen (Grass 1987, S. 181f.).
Die Aussage verdeutlicht zwei relevante Aspekte: Zum einen betont Grass, der den Begriff „Danziger Trilogie“ schließlich nicht selbst prägte, den größeren Zusammenhang zwischen den einzelnen Werken. Zum anderen wird seine Kritik an der Verdrängung und unzureichenden Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der Nachkriegszeit bis in die 1960er Jahre offenkundig, die ihm zufolge mit aktiver und schonungsloser Erinnerungsarbeit, wie sie in seinen Werken stattfindet, zu begegnen seien. Nicht zuletzt trug dieser Umstand dazu bei, dass insbesondere die auftaktgebende „Blechtrommel“ – man beachte, dass Erzählstandort und Erscheinungsjahr in demselben Jahrzehnt anzusiedeln sind – als derart skandalträchtig rezipiert wurde.
Johanna Grad
Textgrundlage:
 Fokalisierung
Bitte lesen Sie zunächst nur den ersten Absatz aus „Die Blechtrommel“ (S. 9f.). Mittels welcher Fokalisierung (intern, extern, Nullfokalisierung) nach dem Erzähltheoretiker Gérard Genette sowie den Wuppertaler Forschern Matías Martínez und Michael Scheffel wird erzählt?
Mit „Fokalisierung“ ist der Blickwinkel gemeint, aus dem die erzählte Welt und das Geschehen darin geschildert werden.
Fokalisierung
Bitte lesen Sie zunächst nur den ersten Absatz aus „Die Blechtrommel“ (S. 9f.). Mittels welcher Fokalisierung (intern, extern, Nullfokalisierung) nach dem Erzähltheoretiker Gérard Genette sowie den Wuppertaler Forschern Matías Martínez und Michael Scheffel wird erzählt?
Mit „Fokalisierung“ ist der Blickwinkel gemeint, aus dem die erzählte Welt und das Geschehen darin geschildert werden.
Bitte lesen Sie den folgenden Textausschnitt: Textausschnitt Blechtrommel
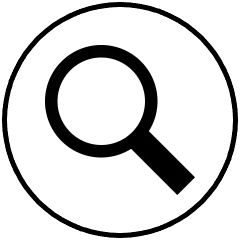 Einordnung der Erzählinstanz
Es ist nun zu fragen, welche Konsequenzen dieser erste Absatz für unsere Lektüre hat. Welche Erwartungen schürt Günter Grass mittels seiner Erzählinstanz? Wie lässt sich die Erzählinstanz jetzt bereits im Kontext von historischem Erzählen einordnen? Bitte wählen Sie unter folgenden Aussagen die Ihrer Ansicht nach zutreffenden aus:
Einordnung der Erzählinstanz
Es ist nun zu fragen, welche Konsequenzen dieser erste Absatz für unsere Lektüre hat. Welche Erwartungen schürt Günter Grass mittels seiner Erzählinstanz? Wie lässt sich die Erzählinstanz jetzt bereits im Kontext von historischem Erzählen einordnen? Bitte wählen Sie unter folgenden Aussagen die Ihrer Ansicht nach zutreffenden aus:
Anne-Rose Meyer
Den Sprechtext des Videos können Sie hier herunterladen
Tab-Inhalt
Tab-Inhalt
Tab-Inhalt








